Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
Die Entwicklung von Verfahren zur Risikominderung im Pflanzenschutz wird vom BMLEH mit folgenden Instrumenten gefördert:
Detaillierte Informationen zu aktuellen nationalen und internationalen Forschungsprojekten und Bekanntmachungen inklusive für den Bereich Pflanzenschutz sind bei den Projektträgern des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu finden unter:
Darüber hinaus hat die Bundesregierung in der Nationalen Bioökonomiestrategie den Pflanzenschutz thematisiert. Die Förderung von Forschungsprojekten im Rahmen der Nationalen Bioökonomiestrategie erfolgt über das Bundesministerium für Forschung, Entwicklung und Raumfahrt.
Mehr zur Nationalen Bioökonomiestrategie
Weitere Forschungsziele und -bereiche von Bund und Ländern sowie die zugehörige Forschungsförderung der öffentlichen Hand werden durch das Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung (FISA) dargestellt.
Für den Projektträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wurde ausgewertet, in welchem Umfang das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) Projekte im Bereich Pflanzenschutz und Resistenzzüchtung im Zeitraum 2013 bis 2023 gefördert hat. Die Auswertung wurde als Poster auf der 64. Deutschen Pflanzenschutztagung im Oktober 2025 präsentiert.
Poster "Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutz: Forschungsförderung des BMLEH 2013-2025"
Im Zusammenhang mit ihren hoheitlichen Aufgaben im Pflanzenschutz führen die Länder eigene Versuche und Modellvorhaben durch. Ziel dieser Aktivitäten ist insbesondere, fachliche Grundlagen für die Offizialberatung der Pflanzenschutzdienste zu erarbeiten. Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz werden die Länder regelmäßig zu ihren Aktivitäten in diesen Bereichen befragt.
Zur Länderabfrage „Versuchs- und Modellwesen zum Pflanzenschutz“
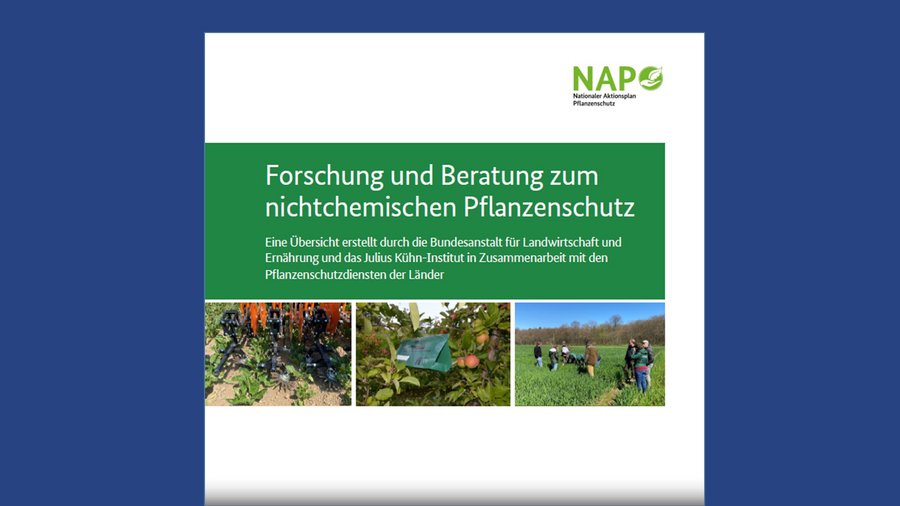
2020 wurden die Länder über ihre Forschungs- und Beratungsaktivitäten zu nichtchemischen Pflanzenschutzverfahren befragt. Die umfangreichen Rückmeldungen zu dieser Abfrage wurden in einer Broschüre zusammengefasst. Ergänzend informiert die Broschüre zu Projekten, die durch das BMLEH gefördert werden und sich mit nichtchemischen Pflanzenschutzverfahren befassen. Dabei werden auch Forschungsaktivitäten am Julius Kühn-Institut als Ressortforschungseinrichtung vorgestellt.
Broschüre „Forschung und Beratung zum nichtchemischen Pflanzenschutz“ (pdf-Datei)
Neu entwickelte nichtchemische und moderne integrierte Pflanzenschutzverfahren tragen nur dann zu den Zielen des NAP bei, wenn diese in der landwirtschaftlichen, gartenbaulichen und forstwirtschaftlichen Praxis integriert werden. Deshalb ist es wichtig, diese auf Praxistauglichkeit zu prüfen und durch intensive Beratung und Anreizsysteme in die Praxis einzuführen. Um die notwendige Brücke zwischen Forschung und Praxis zu schlagen, wurde von 2011 bis 2018 das vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderte Modellvorhaben "Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz" durchgeführt. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse hat das Ministerium ein weiteres Modell- und Demonstrationsvorhaben initiiert. Das Projekt „Demonstrationsbetriebe Integrierter Pflanzenbau“ ist 2023 gestartet und widmet sich den der fachlichen und produktionsbezogenen Handlungsfelder, die in der Ackerbaustrategie 203 des Bundeslandwirtschaftsministeriums benannt werden. Ein Handlungsfeld ist der integrierte Pflanzenschutz. Ziel des Modellvorhabens ist, durch Umsetzung von innovativen Maßnahmen Perspektiven aufzuzeigen, wie Pflanzenbau zukünftig ökonomisch tragfähig, ökologisch vertretbar und gesellschaftlich akzeptiert gestaltet werden kann.
Weitere Modell- und Demonstrationsvorhaben werden regional von den Bundesländern durchgeführt.
Mehr zum Modellvorhaben "Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz" (2011-2018)
Mehr zum Modellvorhaben „Demonstrationsvorhaben integrierter Pflanzenbau“ (ab 2023)
In Langzeitversuchen am Julius-Kühn-Institut wird unter anderem erforscht, wie sich eine Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzes auf den Ertrag und andere Parameter auswirkt.
Mehr zur den Langzeitversuchen des JKI
Ziel ist, das notwendige Maß bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln experimentell abzusichern. Daher werden seit 2002 Langzeitversuche zur Pflanzenschutzmittelanwendung in mehreren Bundesländern durchgeführt.