Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Auf Einladung des Pflanzenschutzdienstes der Landwirtschaftskammer NRW tagten die Arbeitsgruppen "Risikoreduzierung Umwelt" und "Integrierter Pflanzenschutz" vom 19. bis 21. Mai 2025 im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse in Bad Sassendorf. Die Arbeitsgruppen gehören zum Forum NAP, das die Bundesregierung zum Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) berät. Rund 50 Vertreterinnen und Vertreter von Bundes- und Länderbehörden sowie von Verbänden aus Landwirtschaft, Gartenbau, Wasserwirtschaft, Industrie und Handel nahmen an der Veranstaltung teil. Die regulären AG-Sitzungen wurden von einem fachlichen Exkursionsprogramm mit Schwerpunkt Biodiversität und integriertem Pflanzenschutz begleitet.
Bei einer Besichtigung des Betriebs König bei Neuengeseke erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen sehr authentischen Einblick, wie Biodiversitätsmaßnahmen im Ackerbau umgesetzt werden. Landwirt Andreas König bewirtschaftet einen Gemischtbetrieb mit Schweinemast und rund 200 Hektar Ackerfläche im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde. Der Betrieb liegt mit nahezu seiner gesamten Fläche im Heilquellenschutz- und Nitratbelasteten-Gebiet, was mit etlichen Einschränkungen in der Bewirtschaftung einhergeht. Auf etwa 25 Hektar seiner Ackerflächen führt Herr König verschiedene Maßnahmen zum Arten- und Biodiversitätsschutz durch, die unter anderem im Rahmen des Vertragsnaturschutzes gefördert werden. Zusätzlich setzt er auf eine vielfältige Fruchtfolge, was auch der Biodiversität zu Gute kommt. Bei der Planung der Maßnahmen unterstützt ihn die Biodiversitätsberatung der Landwirtschaftskammer NRW, die sich eng mit den regionalen Biologischen Stationen abstimmt.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppen besichtigten Flächen mit den Maßnahmen „Weite Reihe in Getreide“ und „Buntbrache“. Herr König zeigte den AG-Mitgliedern auf seinen Flächen anschaulich, dass die Biodiversitätsmaßnahmen keine „Selbstläufer“ sind. Ebenso wie die Produktionsflächen müssen sie gepflegt werden, damit Zielarten wie Rebhuhn und Grauammer von diesen profitieren können. Die Grauammer galt in der Region fast als ausgestorben. Auf den Flächen des Betriebs ist sie wieder zu finden. Dass die umgesetzten Maßnahmen auch von zahlreichen anderen Arten angenommen werden, zeigten anschaulich die vielen zu beobachtenden Tiere wie Feldhase, Fasan, und Feldlerche – sie flüchteten bei so viel Trubel am Feldrand und begleiteten die Besuchergruppe aus sicherer Entfernung mit regem Gesang.
Weitere Informationen zur Biodiversitätsberatung der Landwirtschaftskammer NRW
Bei einer zweiten Exkursion demonstrierte der Pflanzenschutzdienst NRW den Arbeitsgruppen sowohl langjährig etablierte als auch innovative Verfahren im integrierten Pflanzenschutz (IPS), deren Transfer in die Praxis unter anderem durch das Projekt „Demonstrationsbetriebe Integrierter Pflanzenbau" vorangetrieben wird.
Auf einer Versuchsfläche von Haus Düsse wurden eingangs klassische Fragestellungen des IPS mit den AG-Mitgliedern thematisiert. In einem vorgestellten Parzellenversuch untersucht der Pflanzenschutzdienst NRW in Wintergerste, welchen Einfluss Saattermin, Sortenwahl und die Intensität der Pflanzenschutzmittelanwendung auf das Auftreten von Unkräutern/Ungräsern, Krankheiten und Schädlingen haben. Dass der IPS ein hochkomplexes System aus unzähligen betriebs-, standort-, kultur- und jahresbedingten Komponenten und Maßnahmen ist, zeigt der Blick auf die Varianten aus der Luft. Versuche wie dieser, die sich mit den einzelnen Komponenten des IPS in den verschiedensten Kulturen befassen, sind eine wichtige Basis für die Offizialberatung der Länder und sichern eine unabhängige Beratung zum IPS.
An einem Zuckerrübenfeld bekamen die Mitglieder der Arbeitsgruppen erläutert, wie sich mit moderner Technik im integrierten Zuckerrübenanbau Pflanzenschutzmittel reduzieren lassen. Demonstriert wurden unterschiedliche Techniken wie Band- und Spot-Spritzungen und der Einsatz von Robotik. Die Anwesenden erlebten live eine Kameradrohne, die zur Erstellung digitaler Applikationskarten genutzt wird. Diese können verwendet werden, um eine automatische Teilbreitenschaltung moderner Pflanzenschutzgeräte präzise zu steuern und so beispielsweise Unkrautnester gezielt zu bekämpfen. Wie vor Ort eindrücklich präsentiert, kann diese Technik auch das Risikomanagement beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unterstützen, zum Beispiel um Abstandsauflagen an Gewässern oder Saumbiotopen umzusetzen. Vorführungen zur sicheren Befüllung der Pflanzenschutzspritze mit Close Transfer-Systemen und zur Reinigung der Spritze mittels kontinuierlicher Innenreinigung auf dem Feld rundeten das Thema Risikomanagement und die Exkursion ab.
Die Exkursion bot den AG-Mitgliedern Gelegenheit, mit Landwirten und Beratern des Pflanzenschutzdienstes ins Gespräch zu kommen. Vor Ort waren auch einzelne Demonstrationsbetriebe, die von ihren praktischen Erfahrungen mit der gezeigten Technik berichteten. Gemeinsam tauschte man sich dazu aus, was es braucht, um die vorgestellten Maßnahmen und Verfahren erfolgreich in die Praxis zu bringen. Der Austausch wurde in den AG-Sitzungen fortgeführt und lieferte Impulse für die weitere Arbeit der Arbeitsgruppen.
Weitere Informationen zu den Exkursionsthemen:




















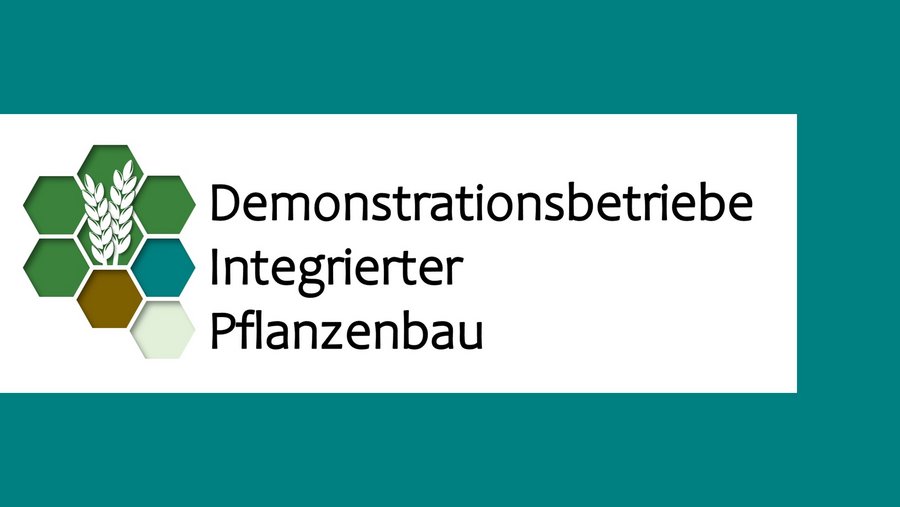
Das Modell- und Demonstrationsvorhaben "Demonstrationsbetriebe Integrierter Pflanzenbau" (MuD IPB) wird seit 2022 durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) im Rahmen der Ackerbaustrategie gefördert. In Anlehnung an die acht produktionsbezogenen Handlungsfelder der BMLEH-Ackerbaustrategie 2035 werden in sieben Modellregionen auf 79 Demonstrationsbetrieben innovative und praktikable neue Maßnahmen und Verfahren auf Praxisebene umgesetzt und demonstriert. So soll die Einführung der Maßnahmen in die landwirtschaftliche Praxis gefördert und beschleunigt werden. In NRW sind neun Demonstrationsbetriebe beteiligt, die von der Landwirtschaftskammer NRW betreut werden. Das Julius Kühn-Institut koordiniert und begleitet das Modellvorhaben wissenschaftlich. Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.